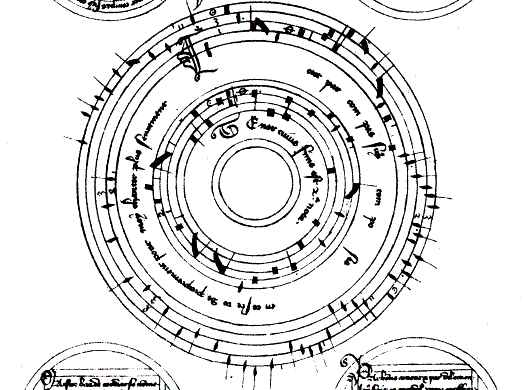
Tutorial: Canon
Tutorial zum improvisierten Kanon
Einführung
Während andere Techniken des improvisierten Kontrapunkts einen vorgegebenen Cantus Firmus benötigen, um in Bezug auf ihn Konsonanzen und Dissonanzen zu bilden, kann man beim Canon einfach ohne vorgegebenem Material loslegen, indem der Dux (führende Stimme) einfach loslegt und der Comes (Gefährte) nach einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten Intervall dieselben Fortschreitungen wiederholt. Auch wenn die beiden Stimmen vom Resultat her fast identisch sind, haben sie dabei völlig unterschiedliche Rollen:
- Der Dux ist derjenige, der hier wirklich improvisiert und die Hauptverantwortung für den resultierenden Kontrapunkt trägt. Er muss bei jeder Fortschreitung die konsequenten Antworten des Comes mit berücksichtigen, um dazu dann sukzessive passende Konsonanzen (mit einer korrekten Stimmführung) zu singen - die dann wiederum vom Comes weiderholt werden usw. Bei einen gemeinsamen Schluss ist er auch derjenige, der den Kadenzvorgang einleitet.
- Der Comes hingegen muss im Prinzip "nur" folgen. Dennoch liegt die Herausforderung für den Comes darin, dass er zugleich singen und den Dux hören muss, um das Gehörte nach dem vereinbarten Abstand zu singen - während man wiederum die nächste Fortschreitung des Dux zuhört usw.
Für Anfänger ist die Rolle des Dux erstmal wesentlich komplexer. Es empfehlt sich also, zuerst als Comes zu üben, denn dadurch trainiert man nicht nur die spezifischen Anforderungen des Comes (simultanes nachsingen und zuhören), sondern man wird darüber hinaus vertraut mit den üblichen Fortschreitungsmuster des improvisierten Kanons. Dieses instinktive "learning by doing" wird später beim Singen des Dux' sehr hilfreich sein, denn diese Fertigkeit ist nicht rein kognitiv, sondern sie wird auch vom "impliziten Wissen" unterstützt, das man en passant durch die Erfahrung als Comes erwirbt.
Zum Üben der Comes Rolle kann man in den folgenden Videos den Dux im vorgegebenen Abstand folgen:
- in der Oberquinte
- in der Unterquinte
- in der Oberquarte
- in der Unterquarte
- in der Oberoktave, Nr. 1
- in der Oberoktave, Nr. 2
- in der Oberoktave, Nr. 3
Im folgenden werden wir sehen, wie man den dux für verschiedene Sorten von zwei und dreistimmigen Canons improvisieren kann. Um die richtigen Fortschreitungen zu wählen, muss man zwei Parameter berücksichtigen: denn zeitlichen Abstand zwischen den Stimmen und den Canonintervall
zeitlicher Abstand zwischen dux und comes:
- Beim improvisierten Canon setzt der comes meistens ein Tactus hinter dem dux ein, manchmal sogar nur einen halben Tactus hinterher. Dadurch ergibt sich aus jeder Fortschreitung des dux automatisch ein bestimmtes Intervall zum comes. Bei bestimmten Fortschreitungen des dux - von einem Tactus (bzw. halben Tactus) zum nächsten, ergeben sich also automatisch Konsonanzen, bei anderen Fortschritungen hingegen (unvorbereitete) Dissonanzen. Innerhalb dieses strukturellen Abstandes von einem (bzw. einem halben) Tactus, sind Diminutionen erlaubt und wünschenswert - auch wenn man gelegentlich auf Parallelen achten muss.
- Folgt der comes zwei Takte hinter dem dux, so ist es zwar noch möglich, bestimmte Fortschreitungsmuster anzuwenden, die Regeln dafür sind aber wesentlich komplexer, denn es gibt dazwischen keine blosse Diminution, sondern einen strukturellen Ton im dazwischen liegenden Takt, zu dem der dux auch eine Konsonanz finden muss. Man muss also auch diese "Zwischenkonsonanz" finden, die sich zugleich aus der Summe von zwei taktweise Fortschreitungen ergibt. Dies ist nicht geeignet für Anfänger, aber es ist machbar, wenn man einige funktionierende Muster lernt.
- Folgt der comes noch wesentlich später, nach dem der dux etwa eine ganze Phrase gesungen hat, so hat die Gleichung zu viele Unbekannten, um dafür automatische Fortschreitungsformeln zu erstellen. Stattdessen kann man die ganze Phrase memorieren (das ist einfacher, wenn man bereits bekannte soggetti nimmt), um dann beim Einsatz des comes diesen als einen cantus firmus zu betrachten, zu dem der Dux einen Kontrapunkt improvisiert.
Canonintervall:
- Der comes kann wörtlich den dux mit denselben Tönen folgen, also im Einklang (in unisono). Ein solcher Canon für gleiche Stimmen, mit einem vielen Stimmkreuzungen und einem relativ geringen Tonumfang, wurde auch in der Renaissance praktiziert, auch wenn das nicht die häufigste Canon form. Der Canon in der Oktave (in diapason) fühlt sich im Prinzim sehr ähnlich an und hat keine Stimmkreuzungen - man muss dabei aber beachten, dass die Fortschreitungsregeln nicht dieselben wie im Einklang sind.
- Bei den meisten Canons und Imitationen in der Renaissance folgt der dux in der Quinte (in diapente) oder in der Quarte (in diatessaron), über oder unter dem dux. Gründe dafür sind, dass Duos vorzugsweise mit Nachbarstimmen besetzt werden (Sopran und Alt, Alt und Tenor oder Tenor und Bass), und dass in diesen Abständen die Intervallkonstellation ganz wörtlich imitiert werden kann. Wenn also z.B. der dux D-E-F (= re-mi-fa = Ganzton-Halbton) singt, dann kann der der comes mit A-H-C antworten, also ebenfalls re-mi-fa, Ganzton-Halbton. 1)

